Wenn ein Kind unterwegs ist, müssen sich Paare mit unterschiedlichen Nachnamen für einen Namen für die ganze Familie entscheiden. Aber welcher Familienname soll es sein, schließlich gilt er dann auch für alle weiteren Kinder? Schwer, sich da einig zu werden. Wir erklären, was überhaupt möglich ist und geben Tipps.
Das Wichtigste in Kürze
- Sowohl Name des Vaters, als auch der der Mutter können als Familienname gewählt werden.
- Eine spätere Umbenennung ist unter bestimmten Umständen und unter Einhaltung von Fristen möglich.
- Doppelnamen aus den Namen der Eltern sind momentan nicht erlaubt.
- Wer das Sorgerecht hat, entscheidet über den Nachnamen. Bei Nichtstun greift irgendwann das Gericht ein und entscheidet, welchen Familiennamen das Kind bekommt.
- Wenn das Kind nach einer Trennung nicht den Namen der/des Alleinerziehenden trägt, kommt es nicht selten zu Problemen.
- Beeinträchtigungen im Alltag, wenn Elternteil und Kind verschieden heißen, sind eher selten.
Der Familienname, was soll das sein?
Das deutsche Recht unterscheidet zwischen Nachname und Familienname. Aber warum? Der Grund ist recht einfach: Die Eltern können unterschiedliche Nachnamen tragen, aber ihre Kinder sollen möglichst nicht unterschiedlich heißen. Deshalb wird einer der elterlichen Nachnamen als Familienname bestimmt.
Welcher Familienname: Vieles hat sich im Namensrecht geändert
Früher gab es in Deutschland keinen Spielraum bei der Namenswahl. Paare waren in der Regel verheiratet, bevor das erste Kind kam. Die Frau nahm bei der Eheschließung den Namen des Mannes an und die Nachkommen hießen automatisch alle so. Wurde ein Kind unehelich geboren, trug es den Namen der Mutter und war damit automatisch gebrandmarkt. Das ist jetzt glücklicherweise anders:
Das ist bei Nachnamen für die Kinder erlaubt
Wenn Mutter und Vater nicht verheiratet sind, darf das Kind den Namen des Vaters oder den der Mutter bekommen. Die Namenswahl gilt dann automatisch für jedes weitere Kind.
Wenn Mutter und Vater bei der Heirat ihre jeweiligen Namen behalten haben, darf das Kind den Namen des Vaters oder den der Mutter bekommen. Weitere Kinder des Paares heißen dann auch so.
Heiratet derjenige Partner neu, bei dem das Kind lebt, darf es einbenannt werden, also den neuen Familiennamen annehmen. Wenn sich Mutter und Vater des Kindes das Sorgerecht teilen, muss der Ex-Partner aber zustimmen. Da hakt es oft. Wenn das Kind bereits 5 Jahre alt ist, muss es ebenfalls zustimmen.
Das ist bisher nicht erlaubt (inklusive Ausnahmen)
Das Kind darf als Familiennamen momentan keinen Doppelnamen aus den Namen seiner Eltern bekommen, um Bandwurm-Namen zu verhindern.
Ausnahme: nach einer Trennung und neuer Heirat, kann das Gericht einen Doppelnamen mit dem alten und neuen Familiennamen genehmigen, wenn der Ex-Partner einer normalen Einbenennung des Kindes nicht zustimmt. Dafür müssen jedoch triftige Gründe vorliegen, beispielsweise wenn der Vater des Kindes sich nicht kümmert oder keinen Unterhalt zahlt.
Ein Doppelname aus den Namen der Heiratenden ist generell nicht als Familienname erlaubt. Aber wenn eine Person mit Doppelnamen neu heiratet, darf dieser Name Familienname werden.
Drei- und Vierfachnamen sind als Familienname fürs Kind ausnahmslos nicht erlaubt. Zusammengesetzte Namen, wie zum Beispiel „von der Heide“, mal ausgenommen.
Wer bei unverheirateten Eltern entscheiden darf
Beide müssen einvernehmlich über den Nachnamen des Kindes entscheiden, wenn der Vater bis einen Monat nach Geburt eine Vaterschaftsanerkennung abgegeben hat und beide eine gemeinsame Sorgerechtserklärung unterzeichnet haben. Ohne eine solche Erklärung hat die Mutter automatisch das alleinige Sorgerecht, das heißt, sie entscheidet über den Familiennamen. Aber auch in diesem Fall kann sie den Namen des Vaters wählen, wenn dieser zustimmt.
Wenn niemand entscheidet, bestimmt das Gericht einen Entscheider. Wenn der berufene Entscheider nichts tut, kann das Gericht nach einem Monat den Namen vorgeben. Meist bekommt das Kind dann den Namen des vom Gericht benannten Entscheiders.
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Namen
Jeder wird die folgenden Fragen anders beantworten. Wichtig ist, dass ihr euch darüber Gedanken macht:
- Trennungen sind leider nicht so selten. Bei wem würde das Kind leben, wenn ihr euch trennt? Diesen Namen sollte es tragen. Gar nicht selten stimmt der getrennt lebende Elternteil einer Namensänderung später nicht mehr zu.
- Der anders heißende Elternteil muss bei Ämtergängen eine Geburtsurkunde dabei haben. Ist das ein Problem für einen von euch?
- Manche Männer (und auch Frauen) haben ein großes Ego. Sie fühlen sich ausgeschlossen, wenn das Kind nicht so heißt wie sie. Den meisten Familien macht das aber nichts aus, man gewöhnt sich daran. Wie ist es bei euch? Und wäre das tatsächlich ein Grund?
Immer im Hinterkopf behalten: Bei einer Heirat können immer noch alle denselben Familiennamen annehmen (Ausnahmen siehe Absatz Namensänderungen).
Wenn Mütter sich für den Namen des Vaters als Familiennamen entscheiden, gibt es kaum Probleme im Alltag. Wahrscheinlicher ist es, dass es dann zu Problemen kommt, wenn sich das Paar trennt. Natürlich auch dann, wenn die Mutter die Familie verlässt. Dieser Fall ist aber seltener.
Nachnamen oder Familiennamen nachträglich ändern: was geht?
Bei bereits Verheirateten ohne Familiennamen muss der auch für weitere Kinder geltende Nachname des Kindes bis zu einem Monat nach der Geburt des ersten Kindes festgelegt werden.
Bei Unverheirateten, die gemeinsame Kinder bekommen, und die einvernehmlich erklären, dass sie eine Namensänderung wünschen, kann der vorläufige Nachname des Kindes in zwei Fällen geändert werden:
- wenn sie erst nach der Geburt eine gemeinsame Sorgerechtserklärung abgeben.
- wenn sie später doch noch heiraten, kann das Kind ebenfalls den neuen Familiennamen bekommen.
Nach einer Scheidung kann die Mutter ihren alten Namen ganz einfach wieder annehmen. Das Kind kann ebenfalls umbenannt werden, wenn der Ex-Partner zustimmt. Tut er dies nicht, kann das Familiengericht im Ausnahmefall entscheiden, wenn das Kindeswohl erwiesenermaßen gefährdet ist.
Wenn der Elternteil, bei dem das betroffene Kind lebt, neu heiratet, kann das Kind den neuen Familiennamen erhalten. Wenn Mutter und Vater des Kindes früher verheiratet waren, teilen sich beide automatisch das Sorgerecht. Der Ex-Partner muss der Namensänderung also zustimmen. Bei unverheirateten Eltern und vorliegender gemeinsamer Sorgerechtsregelung gilt dies ebenso. Stellt sich der Ex-Partner quer, kann auch hier das Gericht bei Gefährdung des Kindeswohls eingreifen.
Ab 5 Jahren muss das Kind jeder Form der Namensänderung beim Standesamt zustimmen. Bis 13 kann es dabei gegebenenfalls durch einen Ergänzungspfleger vertreten werden. Ab 14 muss es in Person zustimmen.
Welcher Familienname wann für das Kind sinnvoll ist: zwei konkrete Beispiele
Beispiel – unverheiratetes Paar
- Frau: Andrea Schmidt
- Mann: Thomas Kubitzki
- Sohn: Theo Lorenz (aus erster Ehe)
- Tochter: Ella ?
Andrea Schmidt und Thomas Kubizki sind seit 3 Jahren ein Paar. Andrea hat aus erster Ehe einen Sohn (Theo Lorenz) mitgebracht, der noch den Nachnamen seines Vaters trägt, weil sein Vater einer Namensänderung nach der Scheidung nicht zustimmte.
Nun ist das erste gemeinsame Kind unterwegs. Es wird ein Mädchen. Thomas möchte gern, dass seine Tochter seinen Namen bekommt. Andrea weiß aus ihrer ersten Ehe, wie das ausgehen kann und möchte das nicht. Eine gemeinsame Sorgerechtserklärung gibt es nicht.
Ein Doppelname ist nicht erlaubt. Was also tun? Hier empfiehlt sich, den Namen der Mutter, also Schmidt, zu wählen. Thomas muss erst einmal damit klarkommen. Sollten die beiden heiraten, können Andrea und Ella seinen Namen immer noch annehmen. Und vielleicht stimmt der Vater von Theo zumindest einem Doppelnamen (Lorenz-Kubitzki) zu, sodass dann alle fast gleich heißen.
Beispiel – Ehepaar mit unterschiedlichen Namen
- Frau: Janine John-Kleiber (geborene Kleiber)
- Mann: Johannes Michel
- Sohn: Justus ?
Janine und Johannes haben vor einem Jahr geheiratet. Janine war schon einmal verheiratet und hatte ihren Doppelnamen aus erster Ehe behalten. Weil sie sich nun damit bereits in ihrer Branche einen Namen gemacht hatte, wollte sie ihn bei ihrer erneuten Heirat nicht abgeben.
Nun ist sie mit einem kleinen Jungen schwanger. Theoretisch könnte das Söhnchen nun den Doppelnamen der Mutter bekommen, der dann automatisch als Familienname gilt. Das will aber Johannes nicht. Schließlich hat sein Sohn mit dem Ex-Mann seiner Frau Janine nichts zu tun. Weitere Kinder würden dann ebenso John-Kleiber heißen.
Hier ist es tatsächlich sinnvoll, wenn nur die Mutter den Doppelnamen trägt und gemeinsame Kinder von Janine und Johannes mit Nachnamen Michel heißen.
Familienname: Das ist bei ausländischen Partnern zu beachten
Das sehr liberale deutsche Namensrecht wird nicht überall anerkannt. Wer einen Partner aus dem Ausland hat, sollte sich daher genauestens über die Bestimmungen in seinem / ihrem Heimatland informieren, damit es später nicht zu Problemen kommt. Da jedes Land andere Regelungen hat, verzichten wir an dieser Stelle auf konkrete Tipps.
Wenn ein deutscher und ein ausländischer Staatsbürger heiraten, darf in Deutschland das ausländische Namensrecht angewendet werden, muss aber nicht. Beide Eheleute entscheiden gemeinsam.
Wenn zwei Ausländer in Deutschland heiraten, von denen mindestens einer hier seinen ständigen Aufenthalt hat, dürfen sie sich ebenfalls für das deutsche Namensrecht entscheiden. Müssen sie aber nicht. Nur unter bestimmten Umständen werden bestehende Namen so geändert, dass sie von den Behörden überhaupt erfasst werden können.
Änderungen im Namensrecht kommen in 2025!
Eine umfassende Reform des Namensrechtes ist beschlossen. Bis diese gilt, müssen viele Verwaltungsanpassungen vorgenommen werden, u.a. bei der IT in den Standesämtern. Dieser Artikel gibt den aktuell gültigen Stand wieder.
Ab 2025 (voraussichtlich ab Mai 2025) wird vieles einfacher! Künftig sollen echte Doppelnamen möglich sein, auch Namensänderungen werden vereinfacht. Die häufigsten Fragen zu den Änderungen findest du hier in der Zusammenfassung.
Fazit
Wenn es noch keinen Familiennamen gibt, ist die Entscheidung, welchen Nachnamen das Kind tragen soll, alles andere als leicht. Schließlich ist der Name fester Bestandteil der Identität der Eltern und eben auch des Kindes. Neben dem Ego stehen auch ganz praktische Überlegungen im Raum. Auch wenn wir dir die Entscheidung nicht abnehmen können, hast du nun das nötige Wissen an der Hand, um eine wohlüberlegte Entscheidung treffen zu können.
Viel Erfolg!
Quellen
- Familienportal des Bundesministeriums für Familie: Namensrecht & Sorgerecht: https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/schwangerschaft-geburt/namensrecht-sorgerecht (abgerufen am 19.4.2022)
- Zeit: Buschmann kündigt mehr Gestaltungsfreiheit bei Familiennamen an: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/namensrecht-familiennamen-marco-buschmann-gestaltungsfreiheit-bundesjustizminister
(abgerufen am 19.4.2022) - Bundeministerium der Justiz: Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2023_Namensrecht.html?nn=110490 (abgerufen am 09.07.2024)

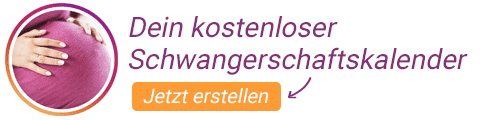
















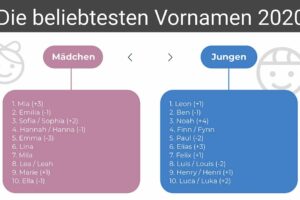



ich würde auf jeden Fall den Nachnamen den die Mutter des Kindes trägt nehmen. Mutter und Kind sind eine Einheit und im praktischen Leben ist es für Mutter und Kind leichter wenn beide denselben Nachnamen haben.
Weiß ich aus eigener Erfahrung.
Das sehe ich auch so, die Mutter hat schließlich die engste Beziehung zum Kind durch Schwangerschaft und Geburt. Mein Kind wird meinen Namen bekommen.
Hallo , ich werde in 6 Monaten Papa
Jetzt habe ich da ein paar Fragen
Wenn wir heiraten sollten “werden beide ihre Nachnamen behalten wollen !das Kind bekommt den Nachnamen der Mutter
Bekomme ich da als Papa Probleme beim doc oder bei den Behörden ? Muss ich mich dann immer ausweisen können das es dann auch wirklich mein Kind ist !??
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Fabian,
Kinderärzte bzw. Arzthelfer interessiert das wenig. Es kann nur sein, dass ihr dann mit dem Namen des Kindes aufgerufen werdet. Bei Behörden kommt es darauf an, was du beantragen willst. Sicherheitshalber solltest du immer eine Kopie der Geburtsurkunde im Portemonnaie mitführen (Oder ein Foto davon auf dem Handy?). Das betrifft natürlich auch unverheiratete Papas und Mamas, bei denen der Name abweicht. Aber keine Sorge, abweichende Namen werden immer häufiger, normalerweise gibt es damit keine Probleme.
Alles Gute!
Hallo! Ich habe eine Frage und hoffe, eine Antwort zu bekommen. Ich bin eine alleinstehende Frau und schwanger von einem deutschen Mann. Ich lebe in Deutschland, habe aber keine Staatsbürgerschaft. jetzt sind wir nicht mehr zusammen. Ich möchte, dass mein Kind den Familiennamen des Vaters erhält. Gibt das dem Vater automatisch das Sorgerecht? Welche Staatsbürgerschaft bekommt mein Kind? und schließlich, wie ich die Vaterschaftsanerkennung bekomme, wenn ich nicht in Kontakt mit dem Vater bin. Ich bin so dankbar für jede Hilfe oder eine klare Antwort.
Hallo Tala,
1. Du kannst deinem Kind den Nachnamen des Vaters geben, wenn er die Vaterschaft anerkennt. Nicht anders herum. Das Sorgerecht ist davon auch getrennt. Das heißt, wenn er die Vaterschaftsanerkennung unterschrieben hat, hat er nicht automatisch das geteilte Sorgerecht. Das müsstet ihr zusammen beantragen. Ansonsten bleibt das Sorgerecht bei dir.
2. Dein Kind kann die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen. Mehr infos findest du hier.
3. Vorsicht, wenn er die Vaterschaft beim Jugendamt oder Standesamt nicht anerkennt. Ohne offiziellen Vater kannst du keinen Unterhaltsvorschuss beantragen. Du könntest aber vor das Familiengericht gehen und die Vaterschaft feststellen lassen. Dann gäbe es einen Vaterschaftstest mit allen Konsequenzen für ihn. Eventuell kann dir das Jugendamt weiterhelfen. Auch sie können eine solches Gerichtsverfahren einleiten. Ich kenne aber deinen Aufenthaltsstatus nicht. Frag am besten einfach nach.
Alles Gute für dich und dein Kind!
Hallo,
Ich habe eine Frage. Mein Sohn 11 Jahre hat meinen Geburtsnamen gehabt, danach haben wir ihm von seinem Vater ändern lassen. Wir sind mittlerweile seit 9 Jahren getrennt und mein Sohn möchte seit längeren seinen Geburtsnamen zurück. Mir wurde gesagt das es aussichtslos ist und das nicht funktioniert. Können Sie mir da weiterhelfen.
LG Helene
Hallo Helene,
ja das erscheint mir leider wirklich aussichtslos, da ihr es ja schon einmal geändert habt.
Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen.
Alles Gute!
Hallo, kann das Kind auch den Nachnamen von meinem Freund bekomme , wenn die Vaterschaftsannerkennung erst nach der Geburt gemacht wird. Also das Sorgerecht steht da ja bis 1 Monat nach der Geburt, aber gilt das auch für die Vaterschaftsanerkennun?
Hallo Angelina,
Ich denke ja. Aber um sicher zu gehen, informiere dich bitte beim Jugendamt bei der zuständigen Stelle. Einfacher ist es natürlich immer, wenn alle Formalitäten vorher schon erledigt sind.
Alles Gute!
Hallo ich hätte eine Frage, ich bin Mama von 2 Kindern leider von verschiedenen Vätern.
Zoé(4) heißt wie ihr Vater G., sie sehen sich auch jedes 2 woe, er zahlt auch Unterhalt.
Mein Sohn Valentin (7)stammt aus meiner 1 Ehe und heißt wie ich L..
Ich möchte nächste Jahr Heiraten und beide Kinder möchten dann mit mir den Nachnamen ändern. Damit wir alle zusammen einen Namen haben.
Gerade für meinen Sohn ist es wichtig, er nennt meinen neuen Partner Papa und hat mit seinen leiblichen Vater keinen Kontakt bzw. Kümmert er sich nicht wirklich.
Valentin wünscht es sich sehr.
Ich habe beide Väter schon gefragt und sie sagten nein.
Für die Kids würde ich auch vors Gericht gehen.
Brauchen wir da einen Anwalt?
Vielen lieben Dank
Hallo Mandy,
ich habe wegen des Datenschutzes die Nachnamen gekürzt, bitte nicht wundern.
Ja, ich denke schon, dass du anwaltliche Unterstützung benötigst. Und es ist auch nicht gesagt, dass das Familiengericht die Väter zwingen wird, einen völlig neuen Familiennamen zu akzeptieren. Habt ihr schon darüber nachgedacht, deinen Nachnamen als Familiennamen zu nehmen? Das würde einiges vereinfachen. Nur Zoés Vater müsste zustimmen und es fiele ihm vielleicht so leichter. Auch das Gericht könnte bei einem anders heißenden Kind besser in eurem Sinne entscheiden. Dein neuer Partner kann ja einen Doppelnamen wählen, wenn er seinen nicht aufgeben will.
Nur so ein Gedanke 🙂
Seh ich genauso. Hab eine Tochter aus einer früheren Beziehung und bin so froh, dass sie meinen Namen trägt, sonst wäre ich ständig mit dem Ex konfrontiert. Jetzt bin ich schwanger vom neuen Partner und wir werden uns absolut nicht einig. Meine Kinder sollen den gleichen Namen tragen, das ist doch wohl nachvollziehbar…
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe von Geburt an einen Doppelnachnamen Müller – Reils. Ich erwarte nun ein Kind und werde allein erziehend sein, ich bin nicht verheiratet. Kann mein Kind den Doppelnachnamen bekommen oder muss ich mich für einen der beiden entscheiden?
Mit freundlichen Grüßen
Nina Müller Reils
Hallo Nina, in diesem Fall kann dein Kind sicherlich den Doppelnamen bekommen. Alles Gute!
Warum soll es nur für den Vater kränkend sein, wenn sein Name keine Beachtung findet?? Ich habe eine Tochter, die den Namen des Vaters trägt. Als Mutter gefällt mir das nicht. Als Mutter soll man gesellschaftlich gesehen ein „Vorrecht“ des Mannes auf den Namen anerkennen (immer noch, im Jahr 2019!), dabei sind wir Frauen es, die die Kinder auf die Welt bringen. Wie jeder weiß, ist das mit großen Mühen verbunden, wird aber immer so abgetan. Ich finde, die Leistungen der Frauen werden hier nicht anerkannt und das empfinde ich als sehr kränkend.
Meiner Meinung nach sollten Kinder grundsätzlich so heißen wie die Mütter, die sie gebären und aufziehen und so viel mehr Kraft und Mühe in ihre Kinder investieren als die Männer.
Das ist echt krank. Und in diesem Text wird absolut das verinnerlichte Klischee: um jeden Preis nicht den Stolz des Mannes verletzen, die Frau will es nur allen recht machen und immer schön demütig sein, und einen eigenen Willen hat sie schon gar nicht…
Es ist meiner Ansicht nach auch eigenartig, wenn eine gestandene Frau, die mitten im Leben steht, bei einer Heirat ihren Namen wechselt. Wer das als Frau nicht tut, muss sich (auch hier immer noch, im Jahr 2019!) leider ständig rechtfertigen und erklären. Unsere Gesellschaft ist leider nicht so aufgeklärt und gleichberechtigt, wie ich immer gehofft habe.
Wir Deutsche sollten einfach mal über den Tellerrand schauen und sehen, wie es in anderen Ländern (z. B. Spanien) gehandhabt wird.
Ich habe noch keine Kinder,aber wenn ich einmal heiraten sollte,môchte ich meinen Nachnamen behalten und vielleicht einen Doppelnamen annehmen.Da meiner seinen Ursprung nicht in Deutschland hat.Und meine Familie die einzige hier ist,die ihn trâgt.
Hallo, ich habe eine Frage: Ich bekomme ein Kind mit einem Mann, der mit einer anderen Frau verheiratet ist. Ungewöhnlicherweise wünsche ich mir, dass das Kind den Namen des Mannes bekommt. Ich selbst verwende nämlich einen Künstlernamen, den ich nicht vererben kann, meinen bürgerlichen Namen will ich nicht weitergeben. Jetzt frage ich mich, ob dem irgendetwas im Weg steht. Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Mein Partner und seine Frau werden sich nicht scheiden lassen, obwohl sie nicht zusammenleben, aber die Verbindung hat eine symbolische Gültigkeit. Mein Partner und ich wollen auch nicht heiraten, für uns stimmt die Konstellation so …
Hallo Lara,
Die Antwort ist einfach. Ja dein Kind kann auch dann den Nachnamen seines Vaters bekommen, wenn ihr nicht verheiratet seid. Wichtig ist hier die Vaterschaftsanerkennung und vor allem das gemeinsame Sorgerecht.
Alles Gute!
Hallo meine Situation ist so ähnlich ich bin schwanger und nicht verheiratet mit dem Kindes Vater wir haben bereits eine Vaterschaft Anerkennung gemacht ich aber habe das alleinige Sorgerecht möchte aber allerdings das das Kind den Nachnamen des Vater bekommt ist das möglich
Hallo Dao,
ja das geht, die Entscheidung liegt bei dir. Denk nur daran, dass es nicht möglich ist, den Namen später in deinen zu ändern, wenn sich die Umstände ändern sollten.
Alles Gute!
Hi, ich hätte da mal eine komplizierte Frage. Folgendes ich bin Deutscher meine Freundin Süd Afrikanerin unser gemeinsamer Sohn ist in Afrika zur Welt gekommen. Wir sind nicht verheiratet, haben in der Geburtsurkunde einvernehmlich den Namen des Vater angenommen. Jetzt sagt die deutsche Botschaft so etwas würde es in Deutschland nicht geben, das wäre nicht Rechtens da wir nicht verheiratet sind . Seid 1998 ist es ja möglich wie können wir das nachweisen?
Danke schon mal alleine fürs Lesen und für die Hilfe
Hallo Thomas,
da ist die Botschaft tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand. Das entsprechende Gesetz findest du hier:
https://dejure.org/gesetze/BGB/1617.html #
Alles Gute! Anke
Guten Tag,
ich habe eine Frage. Ich bin momentan schwanger und nicht verheiratet und möchte gern das mein Kind den Nachnamen meines Partners bekommt. Hat mein Partner dann automatisch das geteilte Sorgerecht, weil unser Kind seinen Nachnamen trägt?
LG
Hallo Sabrina,
meines Erachtens brauchst du für diese Entscheidung lediglich die Vaterschaftsanerkennung, aber kein gemeinsames Sorgerecht. Frag aber bitte vorsichtshalber bei deinem Standesamt nach.
Automatisch bekommt dein Partner das gemeinsame Sorgerecht nicht. Ihr müsstet es zusammen beantragen, wenn du das willst.
Alles Gute!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin verheiratet und ich habe meine Name gehalten. Jetz wir bekommen eine Sohn und wir haben entschieden dass er die Name meines Mann tragen soll.Meine frage ist : ich als Mutter habe ich Sorge rechte oder mein Mann kann alleine entscheiden ,ohne meine zustimmung??
Hallo Jona,
wenn ihr verheiratet seid, teilt ihr euch das Sorgerecht. Das heißt auch, dass ihr zusammen entscheidet, welcher Name der Familienname ist. Dein Mann kann nicht allein entscheiden!
Alles Gute, Anke
Hallo, Frau Modeß. Ich habe auch eine Frage. Meine Schwester hat mit ihrem Freund vor einem ein Kind bekommen. Das Kleine hat gleich den Nachnamen des Vaters bekommen, weil die beiden eigentlich auch heiraten wollten. Nun droht die Beziehung zu scheitern, er wohnt nicht bei ihr, kümmert sich auch wenig bis garnicht um sein Kind. Ab und zu holt er es und parkt es dann bei seinen Eltern. Nun sieht auch noch alles danach aus, dass er eine andere Frau mit Kind am Start hat und dieses wohl auch von ihm ist. Wie stünden denn in diesem Fall die Chancen , wenn meine Schwester ihrem Kind nun wieder ihren Nachnamen geben möchte?
Hallo Kiki,
die Chancen stehen leider nicht gut. Denn die genannten Gründe sind wahrscheinlich nicht gravierend genug, um eine Ausnahme machen zu können.
Die einzige Möglichkeit wäre, irgendwann wieder zu heiraten und das Kind dann „einbenennen“ zu lassen. Das heißt, es könnte dann den neuen Familiennamen (das könnte auch der Ihrer Schwester sein) bekommen. Allerdings nur, sofern der leibliche Vater zustimmt. Denn ich denke, die beiden haben das gemeinsame Sorgerecht, weil das Kind seinen Namen bekommen hat?
Alles Gute für Ihre Schwester!
Hallo Anke,
Ich hab aufmerksam den Artikel und einige Kommentare gelesen.
Wie würde es sich den in folgenden Fall mit den Nachnamen gestalten:
Ein Paar bekommt vor einer Hochzeit ein Kind. Dieses Kind erhält den Nachnamen der Mutter.
Nach beispielsweise 2 Jahren steht bei genau diesem Paar eine Hochzeit an.
Wäre hier dann möglich als Familien Name den Namen des Vaters zu bestimmen?
Ein etwaiges 2tes Kind würde dann den Nachnamen des Vaters tragen… So die Idee.
Kind 1 hätte dann einen anderen Nachnamen als Kind 2 obwohl beide die gleichen Eltern haben.
Wäre das möglich?
Ich freue mich auf eine Antwort.
Beste Grüße
Anna
Hallo Anna,
wenn das Paar bei der Heirat einen Familiennamen festgelegt hat (klar kann das der Name des Vaters sein), darf das erste Kind „einbenannt“ werden. Es darf meines Wissens aber auch den ersten Namen behalten. Für das Kind schöner wäre wahrscheinlich die erste Lösung.
Alles Gute!
Hallo hätte mal eine frage habe schon 3 kinder vom letzten partner die meinen familiennamen tragen so jetzt ist meine frage da ich mit einem neuen partner zusammenlebe und wir ein kind erwarten wollen wir beide das dass kind seinen familiennamen bekommt geht das oder nicht
Hallo Jenny,
ja das geht und ist aus Sicht deines neuen Partners auch verständlich. Ihr solltet euch nur überlegen, ob die Kinder in irgendeiner Form darunter leiden könnten. Deine ersten Kinder könnten sich bei der neuen Familie außen vor fühlen. Und das Kleinste könnte sich ebenfalls ausgegrenzt fühlen, weil es anders heißt als die anderen.
Alles Gute!
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe ein Kind bekommen und er ist in Deutschland geboren. meine Freundin ist Deutsche und ich komme aus Ägypten. ich habe 4 Name mein Vorname, mein Vatername, mein Opas Name und Nachname (Z,B Tim Alex Kaven Keller) 1.darf mein Kind nur ein Vorname und Nachname haben ( z,B Thomas Keller ) 2. wenn er mein Name nehmen, welche Staatsangehörige hat er ?
Hallo,
euer Kind darf nur einen Nachnamen tragen, den ihr als Familiennamen festlegt. Das kann auch der Nachname deiner Freundin sein. Kommt später noch ein Kind, bekommt es denselben Nachnamen. Ihr könnt überlegen, noch andere deiner Namen als zweiten (und dritten?) Vornamen zu geben, wenn es dir wichtig ist, dass die Namen weiter geführt werden. Bis zu 5 Vornamen sind erlaubt. Ob das praktisch ist, ist eine andere Frage. Die Namen müssen vom Standesamt genehmigt werden.
Da deine Freundin Deutsche ist, ist auch euer Kind automatisch deutscher Staatsbürger. Es kann aber dazu den ägyptischen Pass erhalten und hätte damit die doppelte Staatsbürgerschaft. Mit dem Nachnamen hat das nichts zu tun.
Alles Gute!
Ich habe eine etwas knifflige Frage.
Zum Zeitpunkt der Geburt meines 2. Kindes war ich noch mit dem Vater meines ersten Kindes verheiratet. Mein Sohn hat dann automatisch meinen Familiennamen erhalten. Ich habe den Vater meines 2. Kindes nie geheiratet und wir sind auch schon sehr lange getrennt.
Jetzt ist mein Sohn erwachsen und möchte gerne seinen Nachnamen ändern.
Zum einem habe ich das alleinige Sorgerecht, aber da mein Sohn volljährig (26) ist wäre das kein Problem.
Er möchte gerne meinen Mädchennamen annehmen.
Ist das einfach so möglich oder muß ich erst meinen Mädchennamen wieder annehmen damit mein Sohn diesen annehmen kann?
Vielen Dank schon mal
Schwieriger Fall. Denn eine Namensänderung bei Volljährigen ist nur möglich, wenn ein wirklich wichtiger Grund vorliegt:
https://www.gesetze-im-internet.de/nam_ndg/__3.html
Selbst, wenn du den Namen in deinen Mädchennamen änderst, reicht das nicht aus. Ich würde an seiner Stelle einfach mal beim zuständigen Standesamt nett nachfragen, wie die Chancen stehen. Denn ganz so selten ist dieser Wunsch sicher nicht. Alles Gute!
Hallo guten Tag,
Ich bin Ausländer und hat mit meinen Ausländischen Man in unserem heimat land geheiratet. Ich habe aber meinen Name behaltet. Mein Man wohnt immer noch im asuland und nun wir bekommen unsere ersten kind am März. Meine Frage ist, kann unsere kind der Name ihres Vaters tragen?kann ich alleine entscheiden das nachnamen des kinds? Da der vater nicht hier ist?
Danke!
Hallo Alexa, damit kenne ich mich nicht gut aus. Ich denke aber, dass dein Mann in Deutschland dabei sein muss, wenn ihr einen Familiennamen auswählt. Das könnt ihr meines Wissens bis zu einem Monat nach der Geburt tun. Sonst bekommt das Kind automatisch deinen Namen.
Alles Gute!
Hallo, ich hätte eine frage
Ich bin schwanger aber noch nicht verheiratet kann ich dann be ider geburt sagen das ich den Familienname von dem Vater geben möchte da wird irgendwann mal heiraten und ich möchte dann mit mein ledig abschließen.
Hallo,
das geht, wenn:
– dein Freund mit dir zusammen beim Jugendamt die Sorgerechtserklärung unterschreibt (ihr teilt euch das Sorgerecht)
– und ihr auch zusammen den Namen deines Freundes als Familiennamen beantragt.
Für beides habt ihr bis zu 3 Monate Zeit. Aber:
Viele Frauen bereuen das, wenn es mit der Beziehung doch nicht klappt. Eine Möglichkeit wäre, dem Kind deinen Namen zu geben. Wenn ihr heiratet, könnt ihr beide den Namen des Mannes annehmen, wenn du das willst.
Alles Gute!
Hallo Anke,
die Regelungen zum deutschen Namensrecht sind völlig aus der Zeit gefallen und bedürfen einer dringenden Modernisierung. In vielen Teilen Europas ist es selbstverständlich, dass Eltern ihren Namen behalten und Kinder beide Nachnamen der Eltern Tragen: u.a. Frankreich, Belgien, Dänemark, Österreich etc..
Es wundert mich sehr, dass emanzipierte Frauen und Männer sich das in Deutschland einfach so gefallen lassen. Wer jetzt einen Doppelnamen für sein Kind möchte bzw. beide Nachnamen der Eltern, sollte das einfach ggü. dem Standesamt erklären und auf die Arbeitsgruppe der Bundesregierung zur Modernisierung des Namensrechts verweisen und nicht vor der Drohung zurückschrecken, das Familiengericht werde eingeschaltet.
Entscheidend dabei ist, dass sich beide Elternteil einig sind. Denn dann hat des Familiengericht keine Handhabe, den Familiennamen eines Elternteils zu bestimmen. Je mehr Paare diesen Weg gehen, desto höher wird der Handlungsdruck für die Politik.
Viele Grüße
Annette
Aha danke für die Info. Gut zu wissen! Viele Grüße, Anke
Hallo Anke,
ich habe eine Frage. Ich lebe seit April letzten Jahres getrennt von meiner Frau und habe seit Juli eine neue Partnerin, die seit Juli von ihrem Mann getrennt ist. Das heißt wir sind beide noch mit unseren Ex-Partnern verheiratet und die Scheidungen sind bisher noch nicht eingereicht, da das Trennungsjahr noch nicht vorbei ist. Meine neue Parnerin ist Schwanger und wir erwarten im August diesen Jahres Nachwuchs. Kann unser gemeinsames Kind meinen Nachnamen annehmen, obwohl wir beide noch mit unseren Ex-Partnern verheiratet sind?
Danke und viele Grüße
Christoph
Hallo Christoph,
Ja. Wenn du die Vaterschaft anerkennst und ihr das gemeinsame Sorgerecht unterzeichnet, kann euer Kind auch deinen Namen bekommen, wenn ihr das beide wollt. Der Nachname lässt sich aber auch im Nachhinein noch ändern, solltet ihr später heiraten.
Alles Gute!
Super, das freut mich.
Vielen Dank für die Info!!!
LG Christoph
Ist das wirklich korrekt so? Wir sind nämlich aktuell fast in derselben Situation. Ich bin schwanger von meinem aktuellen Partner aber die Scheidung von meinem Ex ist noch nicht durch. Mein Anwalt erklärte mir, dass die Vaterschaftsanerkennung erst dann wirksam ist, wenn die Scheidung durch ist und das Kind vorher meinen Namen bekommen würde, da es ja in die Ehe geboren wird.
LG, Ulrike
Danke für den Hinweis! Ich habe dazu Folgendes gefunden:
https://www.scheidung-siegen.de/familienrecht-siegen/familienrecht-siegen/schwanger-neuer-partner/index.html
Nach dieser Quelle müsste der Noch-Ehemann die Vaterschaftsanerkennung des neuen Partners absegnen. Dann ist sie schon während der laufenden Scheidung gültig. Wenn sich der Noch-Ehemann weigert, kann die durch die Ehe entstandene rechtliche Vaterschaft vom neuen Partner und der Noch-Ehefrau angefochten werden.
Viele Grüße, Anke
Genau, das ist korrekt 🙂 . Nur im oben genannten Fall von Christoph wurde die Scheidung noch nicht mal eingereicht. Von daher mein Hinweis, falls er das noch liest, die Scheidung kann man bei solch einem Fall auch vor dem Ablauf des Trennungsjahres einreichen. Das macht die rechtlichen Probleme wesentlich einfacher. Liebe Grüße, Ulrike
Vielen Dank Ulrike, dass du deine Erfahrungen geteilt hast! Ich hoffe auch, er liest es noch.
Beste Grüße, Anke
Hallöchen, ich habe da mal eine ganz andere Frage. Könnte ich denn auch den Nachnahmen meines Kindes annehmen wenn ich mich von dem Vater trenne?
Hallo Nina,
meiner Meinung nach geht das nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist es eines Tages möglich.
Alles Gute!
Hi!
Ich habe durch eine Erwachsenenadoption einen Doppelnamen. Nun darf ein Kind ja keinen Doppelnamen bekommen?!
Wäre es vllt. möglich dem Kind nur einen Namen aus dem Doppelnamen zu geben? Z.B. meinen Geburtsnamen?
Oder bin ich komplett raus und unser Kind hat automatisch den Nachnamen der Mutter?
Hallo Marcus,
meines Erachtens ist der Doppelname für das Kind okay, wenn du ihn selbst trägst. Bei der Regelung geht es nur darum zu verhindern, dass beide Elternteile ihren eigenen Namen mit einem Doppelnamen weitergeben wollen.
Alles Gute!
Guten Morgen,
Ich bin italienischer Staatsbürger, meine Partnerin (wir sind nicht verheiratet) ist eine deutsche Staatsbürgerin, die derzeit in der Schweiz lebt und arbeitet, aber einen Wohnsitz auch in Deutschland hat. Ich habe auch einen zweiten Wohnsitz in Deutschland, obwohl ich in Italien lebe und arbeite. Im Moment sind wir beide zusammen in Deutschland und in weniger als einem Monat wird unser erstes Sohn hier in Deutschland geboren und wir werden nach der Geburt des Babys noch einen Monat hier bleiben.
Natürlich werde ich meinen Sohn erkennen und meine Partnerin ist damit völlig einverstanden. Aber meine Partnerin möchte keine gemeinsame Sorgerecht. Stattdessen möchte ich, dass unser Sohn meinen Nachnamen hat und dass unsere Sorgerecht vollständig geteilt wird. Ich stelle fest, dass das italienische Gesetz vorsieht, dass die Sorgerecht automatisch geteilt wird und dass die Anerkennung durch den Vater automatisch impliziert, dass der Sohn den Namen des Vaters annimmt. Dies gilt mit der Ausnahme, dass zuvor schwerwiegende Ausfälle oder Verstöße aufgetreten sind; aber in unserem Fall gibt es nichts davon. Hier sind meine Fragen:
– Welche Dokumente sollte ich für die Anerkennung unseres Kindes vorbereiten und wo soll ich sie vorlegen?
– Was kann ich tun, wenn ich mich nicht mit meinem Partner über den Nachnamen unseres Kindes und die gemeinsame Sorgerecht einig bin?
– Was passiert, wenn ich nicht einverstanden bin? Was kann ich tun und an wen und wann sollte ich mich wenden, um eine Lösung zu finden? Und in welcher Zeit wird die Entscheidung getroffen und was passiert in der Zwischenzeit?
– Die personenbezogene Daten des Kindes (Vor- und Nachname des Kindes und gemeinsames oder ausschließliches Sorgerecht für einen der Elternteile) müssen direkt beim Krankenhaus ausgestellt werden, oder muss ich mich an das städtische Standesamt der Stadt wenden, in der das Kind geboren wird?
Welche Rechtsvorschriften werden angewendet, um einen Streit über den Nachnamen und die gemeinsame Sorgerecht beizulegen?
– Kann ich die Anwendung des italienischen Rechts beantragen?
– Welche Chancen habe ich als Vater, unseren Sohn dazu zu bringen, meinen Nachnamen zu tragen, und dass eine gemeinsame Sorgerecht gewährt wird?
Natürlich ist es meine Absicht, in jeder Hinsicht und bis zum Ende eine Vereinbarung mit meine Partnerin zu versuchen, vor allem im Interesse unseres Sohnes, aber ich möchte auch wissen, welche Alternativen es geben wird. Vielen Dank
Danke nochmal und einen schönen Tag und gutes Wochenende
Hallo Tommaso,
nach der Geburt habt ihr bis zu einem Monat Zeit, um dem Standesamt den Namen mitzuteilen. Es geht natürlich auch gleich nach der Geburt im Krankenhaus, das macht es leichter.
Wenn deine Freundin das gemeinsame Sorgerecht nicht will, hast du es in Deutschland ziemlich schwer. Du kannst zwar die „Vaterschaft anerkennen“ (Mutter muss zustimmen), aber ob das Sorgerecht geteilt wird oder nicht, entscheidet bei unverheirateten Paaren die Mutter. Auch über den/die Namen entscheidet bei alleinigem Sorgerecht nur sie. Die Anwendung des italienischen Rechts kannst du meines Erachtens nicht beantragen.
Vor Gericht gehen, ist zwar eine Möglichkeit. Aber ob das klappt und ob das eine gute Basis für die Zukunft ist, kann ich nicht beantworten. Ein Anwalt schreibt dazu das hier.
Welche Dokumente du als europäischer Ausländer für die Vaterschaftsanerkennung einreichen musst, erfragst du am besten beim für euch zuständigen Standesamt. Hier ein Beispiel.
Ohne einen wichtigen Grund gibt es kaum eine Möglichkeit, den Nachnamen im Nachhinein ändern zu lassen. Nur wenn ihr heiratet, klappt es ganz unkompliziert (Mutter muss trotzdem zustimmen).
Alles Gute für euch! Ich hoffe, ihr findet eine Lösung, mit der ihr beide leben könnt. Deinem Sohn wird es ziemlich egal sein, welchen Namen er trägt.
Die Unterstellung, dass die Mutter den Alltag regelt und deswegen bei Behördengängen weniger Komplikationen zu erwarten sind finde ich eine schrecklich patriarchale Sichtweise.
Hallo, Wir haben versucht, das Thema von allen Seiten zu beleuchten. Für konstruktive Kritik sind wir immer dankbar. Aber hier hilft nur eine Textangabe. Deinen Hinweis kann ich so leider nicht nachvollziehen. Vielen Dank.
Hallo Guten Tag,
Ich bin Mexicaner und meine Freundin ist französich und wir wohnen hier in Deutschland, wir sind nicht verheiratet. Jetzt in Mai bekommen wir unsere erstes Kind.
Ich habe zwei Vorname und zwei Familien Namen. Wir beide wollen das unseres Kind mein Nachname bekommt, aber mir gefällt mein Erste Nachname nicht, weil auf Deutsch peinlich ist. Wäre möglich mein zweite Nachname zu unserem Kind geben? und nachdem wir uns verheiraten haben, dass ich mein erste Nachname löschen lasse. Und dass wir drei als Familie mit meiner zweiten Nachname nennen?
Hallo Jorge,
wendet euch am besten an das zuständige Standesamt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das möglich ist.
Alles Gute!
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich weiß nicht, auf welcher Basis die Inhalte Ihrer Tabelle unter „Welcher Familienname – das sind Vor- und Nachteile“ zustande gekommen sind oder wie der oder die Verfasser*in auf so eine Ansicht kommt!? Nicht nur werden dort Väter so dargestellt, dass diese womöglich aufgrund von Formalitäten ihre Beziehung zu dem Kind definieren oder unter Umständen nicht die Charakterstärke besitzen, den Namen der Frau für das gemeinsame Kind zu verkraften, wodurch Sie implizieren, dass diese emotional und charakterlich unzulänglich sind und aufgrund eines uralten und unzeitgemäßen Rollenverständnisses zu schonen wären — denn eine solche Problematik, die bestimmt bei dem ein oder anderen Menschen auch mal vorkommen dürfte, sind (zum Glück, ich würde beide streichen) bei den Nachteilen des Namens des Mannes nicht erwähnt. Die entsprechenden Vorteile, die der Mann dann Ihrer Vorstellung nach bei der Übernahme seines Namens für das Kind hat, führen Sie ebenso entsprechend aus.
Entweder ist die Tabelle aus der Zeit gefallen, oder der Autor/die Autorin. Eine Hilfe ist sie nicht, und ich denke, Sie bezwecken auf dieser Seite, Ihre Leser zu informieren und ihnen auch eine Entscheidungshilfe zu geben, was ja schön ist – was mich betrifft, irritiert diese Tabelle, für die anderen Infos bedanke ich mich herzlich, und hoffe, Sie werfen vielleicht mal einen Blick drauf und sehen, was ich meine!?
Hallo Johanna,
ich verstehe deinen Einwand und denke, dass viele Männer kein Problem damit haben, wenn ihr Kind anders heißt. Leider gilt es aber aus Erfahrung nicht für alle (Aus der Zeit gefallen bin ich ganz sicher nicht ;)). Wir haben versucht, mögliche Nachteile aufzulisten. Das bedeutet ja nicht, dass es auch so kommen muss.
Alles Gute!
Hallo.
Meine Tochter hat meinen Namen und ist 2 Jahre alt.
Der Vater lebt auch bei uns, sind aber nicht verheiratet.
Ich habe bisher das alleinige sorgerecht,
Wollen jetzt aber das gemeinsame sorgerecht beantragen. Kann ich den geburtsnamen dann ändern, sodass sie den namen vom vater bekommt? Und mein name wird nirgendwo mehr auftauchen?
Hallo Lea,
nein, meines Erachtens geht eine Namensänderung jetzt nur noch, wenn ihr heiratet.
Alles Gute!
Hallo,
ich hätte auch eine Frage.
Und zwar bin ich alleinerziehende Mama aber habe oft Kontakt zu dem Kindsvater, der noch bei seinen Eltern wohnt. Ich besuche seine Eltern sehr regelmäßig und dadurch sieht er den Kleinen auch regelmäßig. Wir verstehen uns an sich sehr gut aber er möchte keine Beziehung. Unser Sohn trägt meinen Nachnamen. Nun möchte er dass unser Sohn seinen Nachnamen bekommt. Ich habe das alleinige Sorgerecht.
Geht das überhaupt im Nachhinein? Der kleine ist jetzt 9 Monate.
Und wenn ja, müssen wir uns dann das Sorgerecht teilen?
Danke im voraus
Hallo Many,
nein, eine Namensänderung geht jetzt nicht mehr.
Es sei denn, ihr heiratet.
Alles Gute!
Hallo ich habe eine Frage: (Regenbogenfamilie)
Ich (w) bin seit 2018 mit einer Frau verheiratet. Meine Frau heißt (als Beispiel) Meyer-Kretschmer und ich heiße Kretschmer.
Nun bekommt meine Frau in 4 Wochen unser 1. Kind.
Da wir trotz Eheschließung vom Familiengericht immer noch nicht gleichberechtigt sind kann ich nur das gemeinsame Sorgerecht bekommen wenn ich das kInd über den Weg der Stiefkindadoption adoptiere, was sich bis zu einem Jahr hinziehen kann.
Wäre ich ein Mann würde dies nicht nötig sein, da das Kind in die Ehe hineingeboren wird, egal ob ich der genetische Erzeuger bin oder eben nicht (auf Grund von Krankheit gibt es schließlich mehr als genug heterosexuelle Paare die eine Samenspende in Anspruch nehmen müssen etc., nur fragt eben keiner danach….)
Nun meine Frage: Wird das Kind Kretschmer heißen können oder wird es bis die Adoption durch ist Meyer-Kretschmer heißen?
Liebe Grüße S.
Hallo Susanne,
ich konnte leider nicht herausfinden, wie es sich bei euch verhält. Eine befreundete Regenbogenfamilie konnte auch nicht weiterhelfen, weil die beiden denselben Namen trugen/tragen.
Drücke euch die Daumen, dass es in eurem Sinne läuft. Vielleicht klappt es, wenn ihr es einfach probiert.
Alles Gute!
Hallo, ich hätte eine Frage…
ich bin verheiratet und wir haben keinen gemeinsamen Familiennamen (jeder hat seinen eigenen Namen behalten). Nun bin ich schwanger und wir möchten gerne, dass unser Kind einen Doppelnamen bekommt.
Wenn nun mein Mann und ich unseren Nachnamen in ein Doppelnamen ändern, kann dann unser Kind auch den Doppelnamen bekommen den wir schon tragen?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Hallo Ina,
meines Erachtens sind solche Doppelnamen als Ehenamen nicht gestattet. Wenn, bekommt nur einer von euch den zweiten Namen vorn- oder hintenangestellt. Da ihr schon verheiratet seid, ist eine Änderung in diese Richtung ohnehin schwierig bis unmöglich. Damit soll eben verhindert werden, dass Kinder die Namen beider Eltern tragen und Bandwurmnamen entstehen.
Ich glaube daher eher nicht, dass deine Idee funktionieren wird. Aber die Entscheidung liegt letztlich beim Standesamt. Vielleicht fragst du dort einfach nach.
Alles Gute!
Hallo!
Ist es möglich, dass unsere Kinder verschiedene Nachnamen bei gemeinsamen Sorgerecht tragen ?
Der Sohn heißt wie sein Papa- wir fänden es jedoch schön wenn die Tochter meinen Namen hätte?
Ist das möglich?
Danke für eine Antwort !
Hallo Elena,
meines Erachtens ist das nicht möglich. Ihr müsst euch für einen „Familiennamen“ entscheiden, den dann alle Kinder tragen.
Alles Gute!
Hallo,
mein Mann (Deutscher Staatsangehörigkeit mit ausländischer Würzel) und ich (nicht-EU Ausländerin) erwarten ein Kind. Mein Mann hat zwei Nachname ohne „minus“ Zeichnen (z.B. er hat den Nachname „Müller Scholz“ und nicht „Müller-Scholz“). Können wir selbst entscheiden, das Kind nur einen Nachname zu geben? Also, kann das kind z.B. „Thomas Müller“ und nicht „Thomas Müller Scholz“ heißen?
Danke für eine Antwort!
Hallo,
ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Am besten fragst du direkt beim für euch zuständigen Standesamt nach.
Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr das so festlegen könnt, weil es für dein Kind dann in Deutschland einfacher ist. Dies ist jedoch nur meine persönliche Meinung.
Alles Gute!
Guten Tag,
ich bin volljährig. Mein Vater und meine Mutter waren bei meiner Geburt verheiratet, aber hatten beide ihre eigenen Namen. Nun lassen sie sich scheiden, weil mein Vater unschöne Dinge gemacht hat und er musste auch in eine Psychiatrie dafür. Er hat uns alle traumatisiert und ich hätte gerne den Mädchennamen meiner Mutter. (Eltern haben italienische Staatsangehörigkeit und ich die Doppelte). Würde das eventuell funktionieren? vielen Dank im Vorraus
Hallo,
auch wenn ich es nicht sicher weiß (Genaues erfährst du in diesem Fall bei der Namensänderungsbehörde und nicht beim Standesamt), kann ich mir schon vorstellen, dass das klappen könnte. Es ist schließlich ein triftiger Grund.
Beim Bezirksamt Pankow steht beispielsweise Folgendes dazu:
„Die öffentlich-rechtliche Namensänderung hat Ausnahmecharakter.
Nach geltendem Recht darf ein Vor- oder Familienname geändert werden, wenn ein wichtiger Grund die Änderung rechtfertigt.
Vor- und Familienname stehen nicht zur freien Disposition des Namensträgers. Der Gesetzgeber hat hohe Hürden an eine Namensänderung gelegt, so muss zwingend ein wichtiger Grund vorliegen, um seinen Namen ändern zu können. Ob die für Sie relevanten Gründe auch ‚wichtige Gründe‘ im Sinne des Namensänderungsgesetzes darstellen, sollten Sie vor einer förmlichen Antragstellung mit uns klären.“
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/namensaenderung/artikel.797363.php
Also am besten anrufen und nachfragen.
Wir drücken die Daumen! Alles Gute